Die zehn gängigsten Mythen über Breathwork
Breathwork wird häufig missverstanden – viele denken an Räucherstäbchen oder mystische Rituale. Doch die gezielte Arbeit mit dem Atem ist tief in Jahrtausenden alten Traditionen verwurzelt und heute wissenschaftlich fundiert. In diesem Blogartikel werden 10 verbreitete Mythen entlarvt – mit Humor, Klarheit und harten Fakten.
Mythos 1: „Breathwork? Klingt nach Räucherstäbchen und Klangschale.“
Nein, klingt nach Neurobiologie.
Auch wenn Breathwork seine Wurzeln in alten Traditionen wie Pranayama, Qi Gong oder schamanischer Atemarbeit hat, ist es heute kein exklusives Spielfeld für spirituelle Zirkel. Formen wie Box Breathing oder Physiologisches Seufzen sind inzwischen gut erforscht.
Studien zeigen, dass kontrolliertes Atmen direkt auf das autonome Nervensystem wirkt. Tiefe, bewusste Atmung versetzt den Körper in den Entspannungsmodus, sogar das Stresshormon Kortisol war bei langsamer Atemtechnik niedriger (Fincham et al., 2023).
Mythos 2: „Ich atme doch sowieso – wozu soll ich das üben?“
Richtig. Und du gehst auch – aber ein Marathon läuft sich nicht von allein.
Ja, Atmen passiert automatisch. Aber wie du atmest, beeinflusst maßgeblich, wie du dich fühlst. Die meisten Menschen atmen zu flach, zu schnell oder über den Mund – besonders unter Stress. Das kann Unruhe, Schlafprobleme und Konzentrationsstörungen fördern.
Studien zeigen: Langsames, tiefes Atmen (etwa 6 Atemzüge pro Minute) kann die Herzratenvariabilität verbessern (Zulfiqar et al., 2010) – ein Marker für Resilienz und emotionale Stabilität . Mit etwas Übung wird der Atem zum bewussten Regulierungsinstrument.
Mythos 3: „Breathwork? Das ist doch nur ein Hype!“
Klar, TikTok hat’s auch entdeckt. Aber Breathwork, also die bewusste Steuerung der Atmung, ist älter als jede Trendplattform.
Schon vor über 3.000 Jahren war bewusstes Atmen Teil yogischer, taoistischer und schamanischer Praxis. Und heute? Atemtechniken gehören zur Stressforschung, Traumatherapie und sogar zur Reha nach Long Covid.
Studien wie die von Zaccaro et al., 2018 zeigen, dass Atemübungen neurophysiologische Marker verbessern – also kein Hype, sondern High Impact.
Mythos 4: „Ich hab‘ keine Zeit für so was.“
Hast du Zeit für schlechte Laune, Schlafprobleme und Reizbarkeit? Eben.
Viele Breathwork-Techniken brauchen keine 10 Minuten. Die 4-7-8-Atmung, Box Breathing oder 1-Minuten-Atempausen können schon spürbare Effekte auf Nervensystem und Stimmung haben. Eine Studie zeigte, dass bereits 5 Minuten bewusste Atmung pro Tag die Stimmung besser verbessern konnten als 10 Minuten tägliche Meditation (Balban et al., 2023).
Zeitmangel ist hier also eher eine Ausrede als ein Argument.
Mythos 5: „Da muss man doch hyperventilieren oder anfangen zu heulen.“
Kann passieren – muss aber nicht.
Tiefgehende Methoden wie der verbundene Atem (im Englischen auch Conscious Connected Breathing genannt) können emotionale Prozesse anstoßen – wenn das Setting und die Intention stimmen. Das ist kein Kontrollverlust, sondern eine Einladung zur Integration.
Gleichzeitig gibt es viele regulierende Techniken, die weder intensiv noch emotional sind – sie bringen dich einfach runter, indem sie dein Nervensystem regulieren. Die neurophysiologische Wirkung ist je nach Atemmuster unterschiedlich – ein guter Breathwork Teacher weiß, was wann passt.
Mythos 6: „Wenn’s wirkt, dann sicher nur kurzfristig.“
Falsch geatmet.
Kurzfristige Entspannung ist nur die halbe Miete. Langfristig kann Breathwork z. B. chronische Stressreaktionen, Schlafqualität, emotionale Reaktivität und sogar Entzündungswerte beeinflussen.
So konnten in einer Studie auch signifikante physiologische Veränderungen im Laufe der Zeit nachgewiesen werden (>> Balban et al., 2023). Diese physiologischen Veränderungen waren mit Veränderungen des positiven Affekts im Verlauf der Studie über einen Monat verbunden. Verglichen mit einer Achtsamkeitsmeditation konnte die absichtliche Kontrolle des Atems den Sympathikustonus effektiver senken.
Mythos 7: „Das ist gefährlich.“
Ein Glas Wasser ist auch gefährlich – wenn du reinfällst.
Breathwork ist sicher, wenn es bewusst und in einem passenden Rahmen angewendet wird. Natürlich gibt es Kontraindikationen – z. B. bei Schwangerschaft, Epilepsie oder schwerem Trauma sollte man sich von erfahrenen Guides begleiten lassen. Doch die meisten Übungen sind risikoarm, solange du achtsam und informiert bist.
Genau wie beim Sport gilt: Technik vor Intensität.
Mythos 8: „Breathwork? Ach, das ist doch nur so ein esoterischer Kram.“
Nicht mal ansatzweise – wenn man der Forschung glaubt.
Eine brandaktuelle, peer-reviewed Studie von Havenith et al. (2025) zeigt: Circular Breathwork – also verbundenes, kontinuierliches Atmen über längere Zeit – kann ganz ähnlich veränderte Bewusstseinszustände wie LSD oder Psilocybin erzeugen. In ihrer Studie löste ein messbarer Abfall des CO2‑Spiegels während der Session sogenannte „altered states of consciousness“ aus, darunter Egoverlust, tiefe Einheitserfahrungen und mystische Momente — nachweislich ähnlich den Effekten von Psychedelika .
Und das Beste: Diese Erfahrungen führten nachhaltig zu Verbesserungen bei psychischem Wohlbefinden und Depressionssymptomen – und das ohne Medikamente, Gerichtsbarkeit oder teure Klinikzeit .
Mythos 9: „Ich hab‘ das mal probiert – hat nichts gebracht.“
Klar, einmal Kniebeugen machen auch keine Muckis.
Breathwork ist eine Praxis – keine Zaubershow. Es braucht Wiederholung, ein bisschen Wissen über passende Methoden und manchmal jemanden, der dich begleitet.
Die neurophysiologischen Veränderungen stellen sich oft nicht beim ersten Mal ein. Aber viele spüren schon nach wenigen Minuten erste Effekte – besonders bei täglicher Anwendung.
Mythos 10: „Das ist nichts für rationale Menschen wie mich.“
Gerade du wirst es lieben.
Breathwork ist kein Mindset-Mantra, sondern somatische Arbeit, die zahlreiche Auswirkungen haben kann. Es spricht das limbische System, den Hirnstamm und das autonome Nervensystem direkt an. Besonders spannend: Studien mit fMRT zeigen, dass langsames Atmen die Aktivität in Hirnarealen verändert, die für Angstverarbeitung zuständig sind (Zaccaro et al., 2018).
Das ist Biologie, keine Romantik. Und gerade für Menschen, die „im Kopf“ leben, oft der erste echte Zugang zum Körper.
Enjoy.
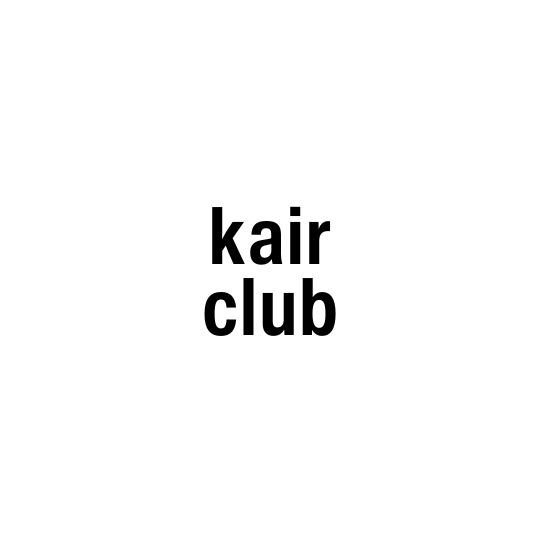
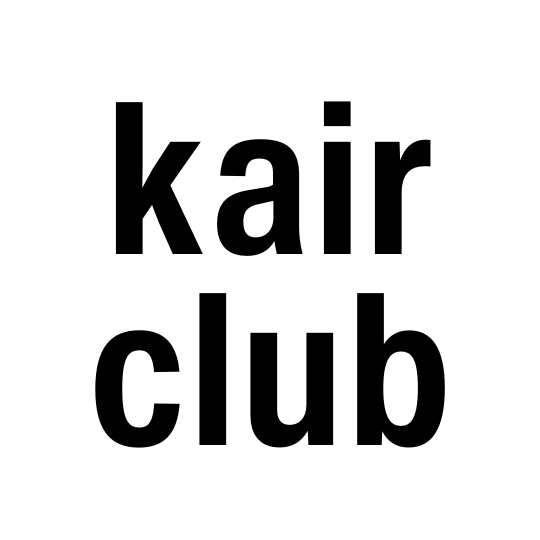
 Elīna Arāja via Pexels
Elīna Arāja via Pexels

